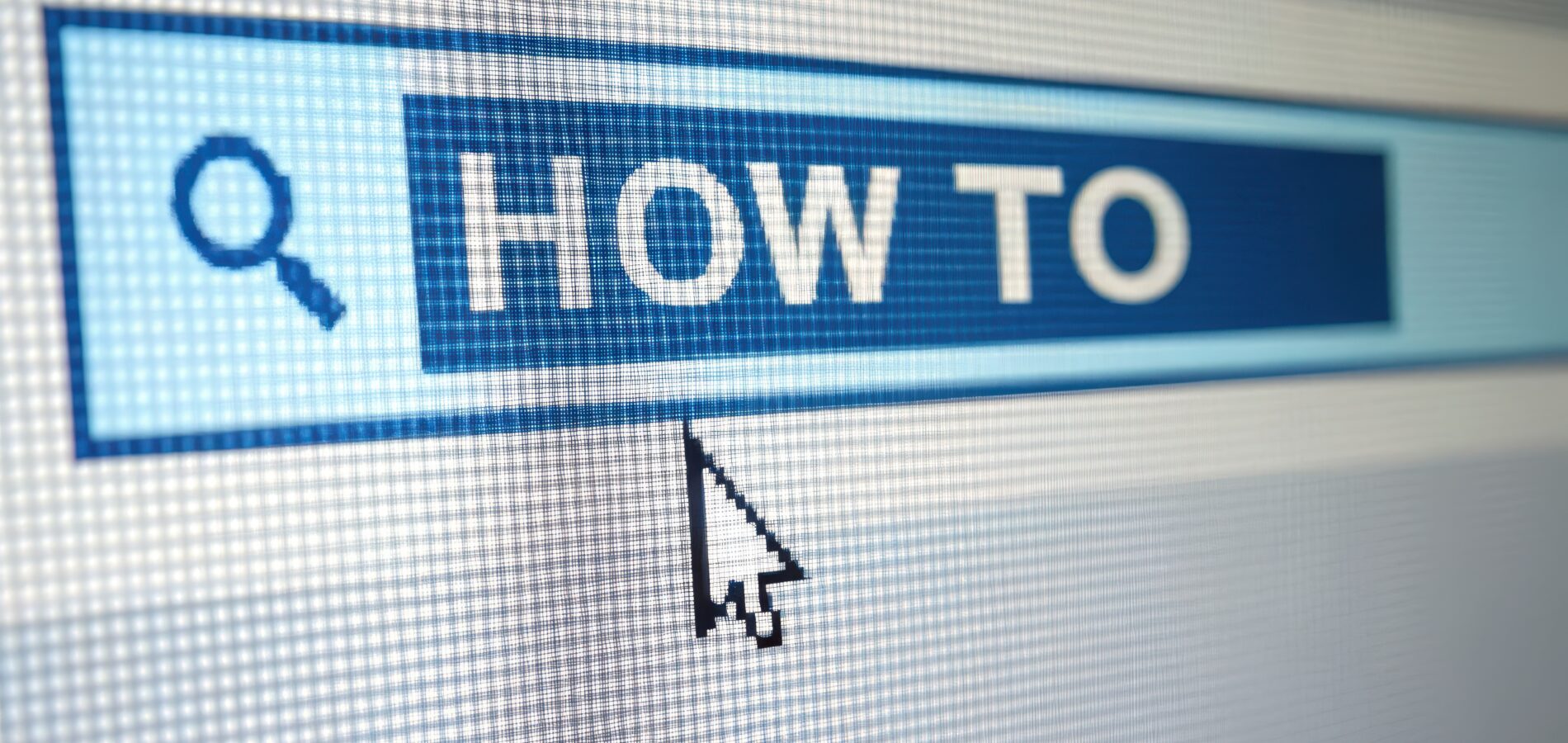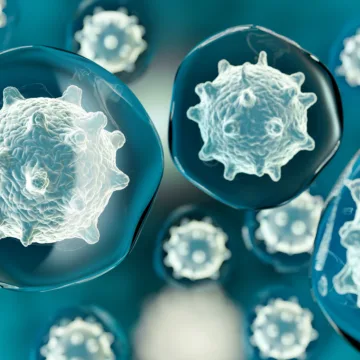Website-Barrieren beheben: Eine kompakte Anleitung in 6 Schritten
1. Prüfen, ob das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) gilt
Zuerst sollte geprüft werden, ob die eigene Website unter die Regelungen des BFSG fällt. Betroffen sind Hersteller, Händler und Importeure, die Produkte oder Dienstleistungen für Verbraucher anbieten. Reine B2B-Angebote sind davon ausgenommen – es muss jedoch eindeutig erkennbar sein, dass keine Leistungen für Privatpersonen erbracht werden.
Tipp: Mithilfe des BFSG-Check kannst Du prüfen, ob Du vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betroffen bist.
2. Barrieren analysieren
Im nächsten Schritt erfolgt eine gründliche Prüfung der Website. Hierbei helfen Tools wie WAVE, der W3C Validator sowie manuelle Tests. Alle gefundenen Barrieren sollten systematisch in einem Prüfbericht dokumentiert werden – am besten mit Hilfe einer Vorlage wie dem „Prüfbogen Barrierefreiheit nach WCAG 2.1 AA“. Ein strukturierter Prüfbericht sorgt für Übersichtlichkeit, unterstützt bei der Planung konkreter Maßnahmen und bildet die Grundlage für die Erstellung einer Barrierefreiheitserklärung.
(Mehr zu kostenfreien Tools im vollständigen Artikel).
3. Barrieren beheben
Die dokumentierten Barrieren werden abgearbeitet und technisch behoben.
4. Wirksamkeit prüfen
Nach der Behebung der Barrieren sollte die Website erneut getestet werden und die neuen Ergebnisse im Prüfbogen ergänzt. So lässt sich ermitteln, ob alle Barrieren tatsächlich behoben wurden oder ob weiterer Handlungsbedarf besteht.
5. Barrierefreiheit erklären
Nun wird eine Barrierefreiheitserklärung erstellt, zum Beispiel auf Basis der Vorlage nach dem ThürBarrWebG. Sie sollte folgende Inhalte enthalten:
-
eine Auflistung der Inhalte, die nicht vollständig barrierefrei sind,
-
Begründungen für bestehende Barrieren und gegebenenfalls Hinweise auf barrierefreie Alternativen,
-
eine Beschreibung des Feedbackverfahrens zur Meldung von Barrieren,
-
einen Hinweis auf das Durchsetzungsverfahren inklusive Link zur zuständigen Stelle.
6. Veröffentlichung und Kommunikation
Die Barrierefreiheitserklärung sollte gut sichtbar auf der Website eingebunden werden – zum Beispiel im Footer oder Impressum. Außerdem ist sie regelmäßig zu aktualisieren, insbesondere nach technischen Änderungen oder neuen Prüfungen. So bleiben alle Nutzer stets auf dem aktuellen Stand über den Barrierefreiheitsstatus der Website.