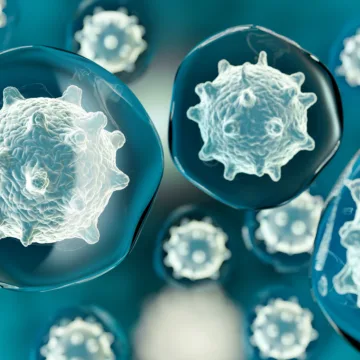Wie lösen Sie denn das Fitnessproblem, mehr Sit-Ups für die KI?
So in der Art: Wenn wir feststellen, dass die KI nicht mehr leistungsfähig ist, kann sie nachtrainiert und aktualisiert werden, sodass sie produktiv arbeiten kann. Mit unserem direkt einsetzbaren AI Guard ist es möglich, direkt auf einer Produktionsanlage oder direkt am Medizinprodukt festzustellen, wie gut die integrierte KI gerade läuft und sie so mit wenig Aufwand aktuell zu halten. Würde sie eine Weile unbemerkt mit geringer Leistungsfähigkeit laufen, würde z.B. mehr Ausschuss produziert und ggf. hohe Verluste entstehen. Dies kann einfach unterbunden und durch den AI Guard sichtbar gemacht werden, sodass die Ausschusserkennung ohne Unterbrechung gut funktioniert und eine Produktivitätssteigerung langfristig gewährleistet werden kann.