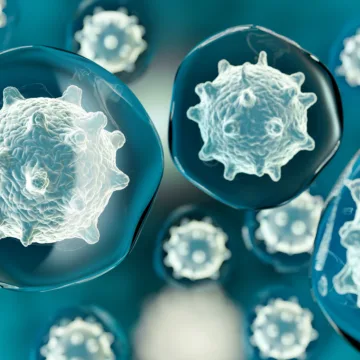Menschliche Kontrolle
Einer der größten Bedenken gegenüber KI ist die Angst vor einem Verlust der menschlichen Kontrolle. Besonders in sicherheitskritischen Bereichen wie der Medizin, der Justiz oder der Verkehrssteuerung muss gewährleistet sein, dass Menschen in der Lage sind, die Entscheidungen der KI zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Die Kombination aus KI-gestützten Entscheidungen und menschlicher Kontrolle bietet den Vorteil, dass die Effizienz und Präzision der KI genutzt werden kann, während Menschen weiterhin die letztendliche Verantwortung tragen. Dies ist besonders wichtig in Situationen, in denen ethische oder moralische Entscheidungen gefragt sind, da KI keine Empathie oder menschliches Urteilsvermögen besitzt. Beispiele, wie menschliche Kontrolle integriert werden kann: