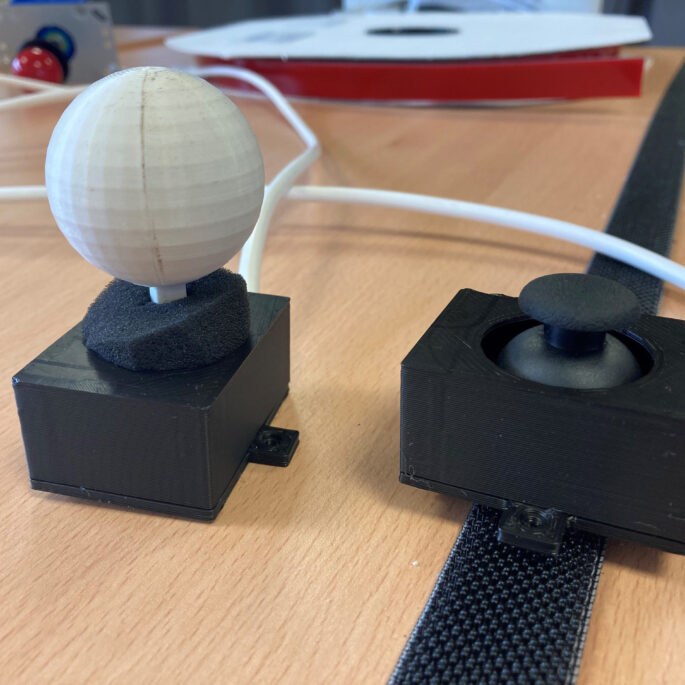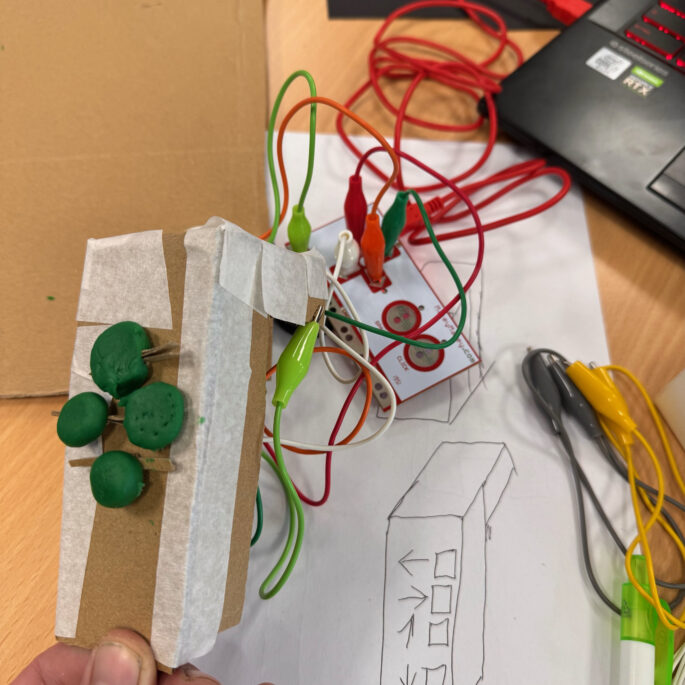Die Bandbreite der Themen die Videospiele verhandeln und der Geschichten, die sie interaktiv erlebbar machen, wächst kontinuierlich. Abseits der populärsten Entertainment-Shooter, Fußball- und Rennspiele thematisieren heutige Games unter anderem Traumata im Spiel "Hellblade: Senua’s Sacrifice" oder in der "Life is Strange"-Reihe. Letzteres setzt einen weiteren Schwerpunkt bei den Themen Identität, Beziehung und Empowerment. Prekäre Lebensbedingungen, staatliche Machtstrukturen, Krieg und Moral werden in Spielen wie "This war of Mine" oder "Papers Please" erlebbar gemacht. "It Takes Two" stellt Kommunikation und Kooperation in den Mittelpunkt, "ABZÛ" zeigt die Verbundenheit zu Natur und Umwelt auf.
Bislang wird das Thema Behinderung in Videospielen selten und dann oft sehr oberflächlich dargestellt. „Die meisten behinderten Charaktere haben gemeinsam, dass ihre Behinderung im Verlauf der Handlung geheilt wird. Meist passiert dies in einer schmerzhaften Operation oder durch einen quälenden magischen Eingriff. So wird vermittelt, dass eine Behinderung grundsätzlich etwas Schlechtes ist, das es, selbst unter sehr großen Schmerzen, aus der Welt zu schaffen gilt. Darüber hinaus werden Behinderungen oder Hilfsmittel behinderter Menschen auch gerne als Horror-Element genutzt“, so Melanie Eilert im Handbuch Gameskultur.
Auch wenn in Bezug auf Repräsentanz von Behinderung in Videospielen noch Luft nach oben ist, hat sich im Kontext Barrierefreiheit und Gaming in den letzten Jahren einiges getan. Bei den Video Game Awards – vergleichbar mit den Oscars – werden aktuelle, herausragende Titel ausgezeichnet. Neben den (frei übersetzten) Kategorien „Beste Story“ oder „Bestes Action Spiel“ werden auch die größten Innovationen der Barrierefreiheit prämiert. Eine ähnliche wertschätzende oder motivierende Kategorie für Videospiele fehlt beim hiesigen Äquivalent, dem Deutschen Computerspielpreis, bislang.